„Ich habe nie mit so freudiger Begeisterung an einem Buch gearbeitet, wie an diesem, obwohl es eine traurige Geschichte erzählt und in einer schwierigen Zeit geschrieben wurde“, sagt die Kanadierin Rivka Galchen über ihr neues Buch „Jeder weiß, dass deine Mutter eine Hexe ist“. Mir ging es bei Lesen wie der Autorin beim Verfassen.
Es ist die fiktionalisierte Geschichte von Katharina Kepler, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts in einem sechsjährigen Hexenprozess gequält, aber letztlich freigesprochen wurde. Die Geschichte besticht aus dem Blickwinkel einer besonderen, starken und letztlich unabhängigen Frau erzählt, vermittelt durch die Aufzeichnungen ihres Freundes, Nachbarn und zeitweiligen Rechtsbeistands Simon. Die Stimme Keplers, der Mutter des kaiserlichen Hofastronomen Johannes Kepler, gibt ein eindringliches Bild der Umbruchszeit zwischen Reformation, Dreißigjährigem Krieg und wiederkehrenden Pestepidemien – aber auch etwas sehr Bekanntes: Fake News, Schuldzuweisungen und hysterische Verurteilungen in der – nicht social-medialen, sondern kleinstädtischen – Öffentlichkeit von Leonberg.
Alida Bremers „Tesla oder Die Vollendung der Kreise“ ist kein, wie man erwarten könnte, Buch über von selbst rundum fahrende Elektroautos (wiewohl ein solches ganz am Ende vorkommt). Die fiktionalisierte Geschichte des kroatischen Arztes Ante Matijaca handelt nicht nur „über die Sehnsucht nach dem Neuen“ (Klappentext) sondern vielmehr von der Suche nach Bestimmung, Sinn und Aufgabe – und das als Geschichte von Exil, Rückkehr, der Historie Dalmatiens und dann Jugoslawiens im 20. Jahrhundert sowie vom beinahe Untergehen in dessen Krisen und Kriegen.
Sehr gut gemacht würde ich sagen, an vielen Stellen berührend. Auch wenn der letzte Teil des Textes, in dem das schriftliche Vermächtnis Matijacas ausgebreitet wird und ein Geheimnis des Buches aufgelöst wird, als eine nicht notwendige, etwas bemühte Draufgabe erscheint. Ein offenerer Schluss hätte mir besser gefallen.
Und Nikola Tesla, der nach New York ausgewanderte, im ehemaligen Jugoslawien hochverehrte serbische Erfinder? Er dient in dieser Geschichte Ante als Ikone, als Reflexionspunkt des eigenen Lebens und dem Land Jugoslawien als Held, der im Rest der Welt unbekannt bleibt, ja, bis eines Tages ein Auto nach ihm benannt wird.
Tipp! https://www.literaturschiff.at/: Alida Bremer – Tesla oder Die Vollendung der Kreise; Lesung und Gespräch | Moderation Dominika Meindl; 20.01.2024, 19:30; Eferdinger Gastzimmer, Schmiedstraße 11, 4070 Eferding
Und es erinnert an Patrick Modianos Paris-Geschichten, wenn auch weniger luftig, derber, irgendwie – sozusagen – wienerischer.
Hüseyin Yilmaz war Gastarbeiter der ersten Generation in Westdeutschland. Nach 30 Jahren pausenloser Schufterei stirbt er in dem Moment, als er mit Rentenbeginn seinen Traum einer eigenen Wohnung in Istanbul verwirklicht hatte. Sein Tod vereint die teilweise zerstrittene Familie in dieser Wohnung – mit ihren Ängsten, Hoffnungen, ihrer Verzweiflung. Aydemir lüftet ihre Geheimnisse präzise und einfühlsam. Die Perspektiven der einzelnen Familienmitglieder zeigen, dass sie trotz der Unterschiede, die die Generationen trennt, in mindestens einer Sache nah beieinander sind: dem Gefühl der Heimatlosigkeit. „Dschinns“ vereint Fragen nach Identität, Geschlecht und Herkunft ebenso wie die Themen Rassismus und Diskriminierung, während gleichzeitig ein Teil jüngerer deutscher Geschichte behandelt wird, der bisher kaum in der Literatur zu finden ist.
In den letzten Sommertagen hineingefallen, hineingezogen in „RCE #RemoteCodeExecution“ der „wunderbaren“ (Zitat Stermann und Grissemann) Sibylle Berg.
Ist es ein Roman, wie es am Cover steht, oder eine Textfläche? Beides, aber schon stärker letzteres – quasi Elfriede Jelinek in leichter Sprache.
Ist es Belletristik oder ein Sachbuch? Der Plot ist simpel, aber über weite Strecken spannend gemacht (auch wenn Wiederholungen das Lesevergnügen manchmal trüben; die „speedige“ Sprache entschädigte mich dafür) – eine Gruppe junger Hacker rettet die in Neoliberalismus, Globalisierung und Überwachung untergehende Welt (oder versucht es zumindest, mir fehlen noch die letzten Seiten).
Aber ein soziologisches Werk, eine treffende Weltbeschreibung ist es jedenfalls. Beispiel gefällig?
„Die Fitten, die ihr Humankapital in Form halten, fanden ihr Leben fantastisch. Sie filmten sich beim Fantastischfinden. Sie hatten nichts zu verbergen. Ihre Vorbilder waren Konzernchefs, Macher, mutige Männer. Von den sie radikalisiert wurden. … Die westlichen Kleinbürgerkörper verformt und kurz vor dem Zusammenbruch, der Anspruch, zu einem genormten, energiegeladenen, einheitlich funktionierenden beschäftigen Konsumkörper zu werden, am Rande des Wahnsinns.“ oder „Die Massen, die früher akzeptiert hatten, dass sie für das Land, das einmal allen gehört hatte, Pacht zahlen mussten, entscheiden heute demokratisch, dass Milliardäre keine Steuern zahlen mussten. Und hatten sich daran gewöhnt, dass es Menschen gab, denen wegen ihrer Leistung mehr zustand.“
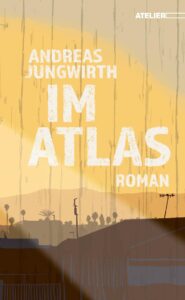
Das neue Buch meines Bruders Andreas Jungwirth, als Hörspiel mit dem Titel „Peace“ habe ich es schon gehört.

Wenderomane, Geschichten aus der Zeitenwende nach 1989, konnten wir einige lesen. „Der Turm“ von Uwe Tellkamp, der sich zuletzt rechtspopulistisch verirrte, war für mich 2008 der erste. Zuletzt, 2020, zwei Bücher, die unmittelbar nach dem DDR-Zusammenbruch in den Berliner Hausbesetzerszenen angesiedelt sind: Bude, Munk und Wieland mit „Aufprall“ sowie „Stern 111“ von Lutz Seiler. Letzterer legte schon davor mit „Kruso“ eine Story vor, die auf der Insel Hiddensee im Milieu der Saisonarbeiter und gesellschaftlichen Aussteiger zum Ende des Arbeiter- und Bauernstaates spielt.
Und nun wurde Sasha Marianna Salzmann mit „Im Menschen muss alles herrlich sein“ auf der Longlist es Deutschen Buchpreises nominiert – zu Recht würde ich meinen. Zu Beginn des Romans treffen sich zwei Mütter und Töchter, Auswanderinnen aus der Ukraine, nach einem Geburtstagsfest in dramatischer Begegnung. Und dann läuft die Geschichte mit vielen Rückblenden in die Zeit der Perestroika und das Zuwandererlebens im Osten Deutschlands genau wieder auf diese Begegnung zu. Damit sind auch die beiden Stränge des Buches benannt: einerseits, was mit Menschen geschieht, wenn es politische Systeme zerreißt; anderseits das Ringen um Beziehung, Nähe, Intimität und Verständnis zwischen Müttern, Töchtern und deren Vätern. Salzmann erzählt mit starken und auch manchmal mehr als komischen Bildern – wenn etwa der Mann vom Schlüsseldienst Gorbatschow ist und unter seiner Arbeitshose ein rotes Spitzhöschen hervorlugt. Berlin eben, wie eine der Protagonistinnen lapidar meint.
Josef von Neupauer schreibt 1893 ein sozialpolitisches Science-Fiction-Werk, das in Dresden bei E. Pierson erscheint. Tobias Roth entdeckte den Roman wieder – 2020 neu aufgelegt unter „Österreich im Jahre 2020“. Am 13. Juli 2020 begeben sich zwei Amerikaner auf eine Reise durch ein exotisches und rätselhaftes Land in der Staatenunion Europas: Österreich.
Das Land hat keine Armee und in Wien stehen nur noch drei Kirchen. Es herrscht Wohlstand. Die Gütergemeinschaft ist friedlich und sanft. Kaiser und Adel sind glitzernde Statisten einer klassenlosen Gesellschaft.
Eine bizarre Geschichte, die lesenswert ist, wenn man überraschende Plots, Perspektivenwechsel und verwirrende Blickwinkel mag.
Wenn alle über Heimat, Terror und Krise reden, dann einen wirklich guten Heimatroman, ein Buch über Heimaten, Erinnerungen und Erfindungen, Sprache und Scham, Ankommen und Zurechtkommen, Glück und Tod. Saša Stanišić, geboren in Višegrad im ehemaligen Jugoslawien, lebt in Deutschland und legt mit „Herkunft“ sein bisher schönstes Buch vor. Dafür gab es auch den Deutschen Buchpreis 2019.
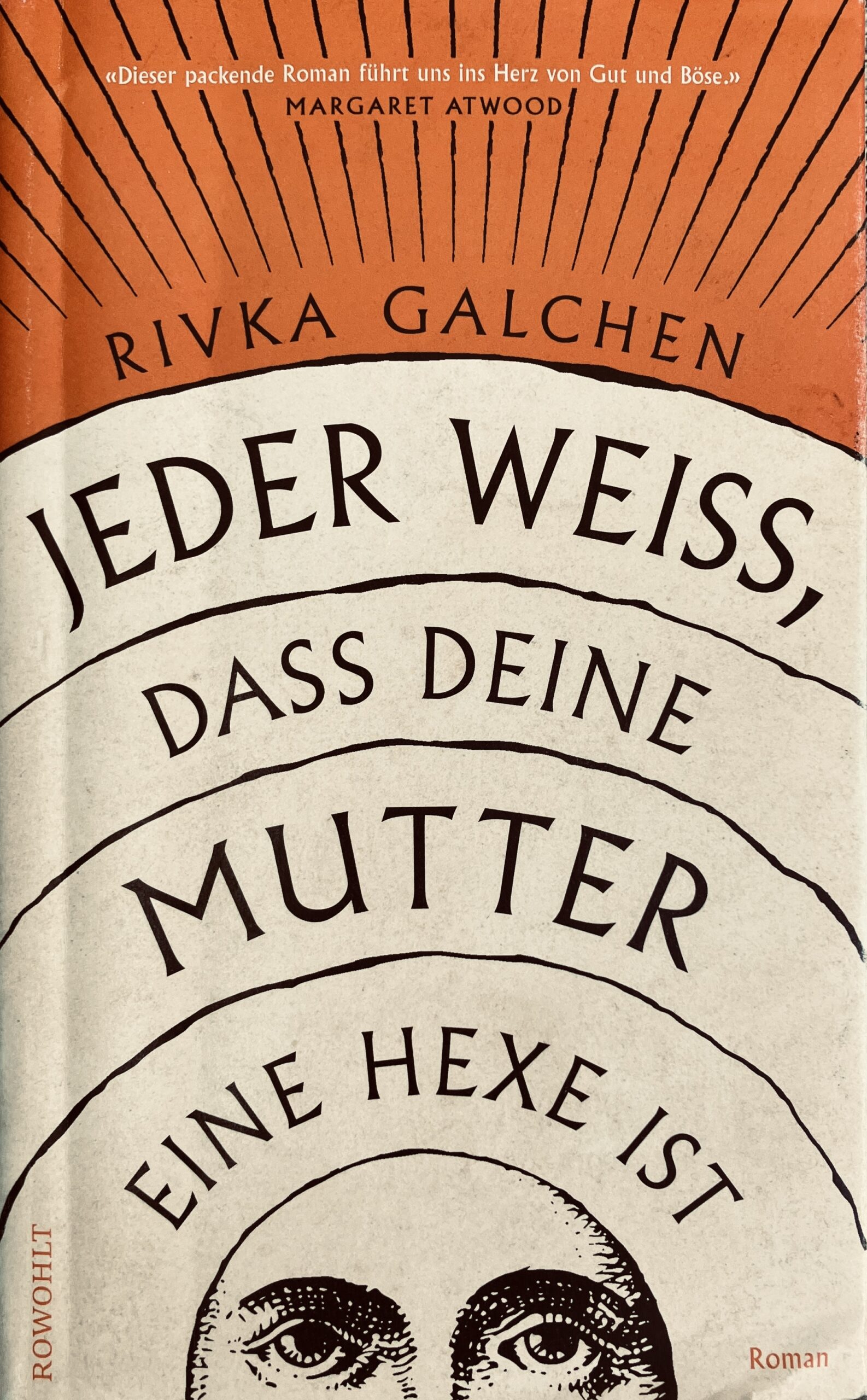
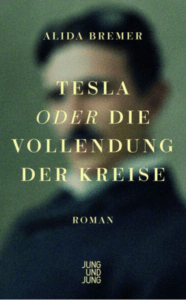
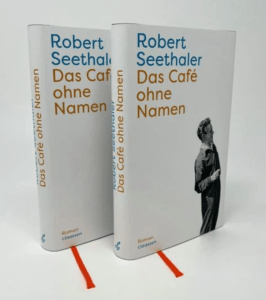
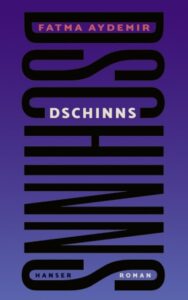
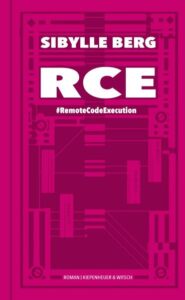
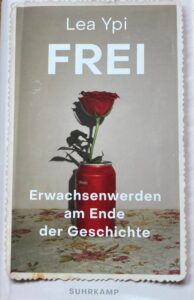
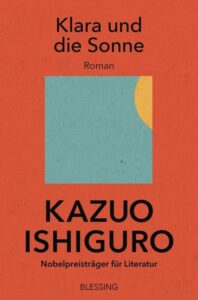


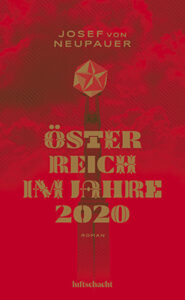
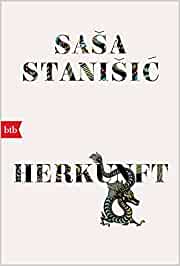
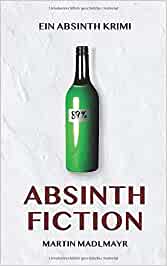
Gerhard Strasser :
ich bedanke mich für die Buchempfehlungen und bitte um die Aufnahme in den weiteren Verteiler 🙂
kati Schamun :
Lieber Christoph,
was eine schöne Idee hier Deine Leserfahrungen zu teilen. Einige von Deinen Empfehlungen habe ich auch schon verschlungen und andere kommen auf meinen „SuB“ (Stapel ungelesener Bücher), der sich nur leider nie in der gewünschten Geschwindigkeit abarbeiten lässt. Aber nun. Die Tage werden ja bald wieder kürzer und dann ist auch wieder mehr Zeit zum Lesen.
Mir sind bei Deinen Inspirationen auch noch zwei tolle Bücher eingefallen, die ich unlängst las: einmal Hexe: „Marschlande“ und einmal Coming of age: Paradise Garden. Vielleicht sind die ja auch was für Dich.
herzlich Kati
Christoph Jungwirth :
Danke